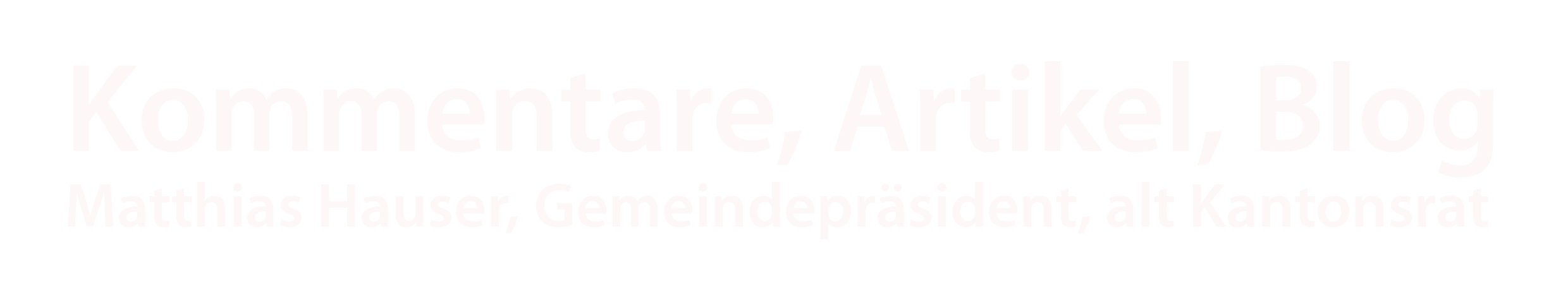Am Sonntag, 24. September 2017, hat das Zürcher Stimmvolk das geltende Gesetz über die Jugendheime und Pflegekinderfürsorge mit 74.5 Prozent der Stimmen unterstützt. Am Montag, 2. Oktober, warf es der Kantonsrat trotzdem über Bord in dem er ein neues Kinder- und Jugendheimgesetz beriet. Es geht um 300 Millionen und alle Parteien mit Ausnahme der SVP werden in der Heimlandschaft die Planwirtschaft einführen.
Erinnern Sie sich an die schrecklichen Bilder aus den kommunistischen Kinder- und Jugendheimen, nach dem sich in den 90ziger Jahren der Eiserne Vorhang öffnete? Es wurde offensichtlich, was in jedem Wirtschaftsbuch steht: In der Planwirtschaft wirken sich fehlende Motivation, zentrale Planungsfehler der Verwaltung (Misswirtschaft) und die Anfälligkeit für Korruption menschenverachtend aus. Es ging dem Ostblock wirtschaftlich nicht gut, die Kinder- und Jugendheime aber wurden richtiggehend ausgehungert.
Freie Zürcher Heimlandschaft
Im Kanton Zürich gab es immer wieder enthusiastische Personen, die im Arbeitsalltag oder familiären Umfeld den echten Bedarf erkannten und freiwillig eine Betreuungseinrichtung für Kinder- und Jugendliche gründeten. Wirklicher Bedarf als Triebfeder eines sozialen Engagements. Finanziert werden die Heime vor allem von denjenigen, die ihr Kind erziehen müssten, von den Eltern, und oft, weil diese nicht bezahlen können, von den Gemeinden innerhalb der Sozialkosten oder von Schulgemeinden, bei Schulheimen. Und vom Kanton. Fakt ist: Die Existenz eines Kinder- oder Jugendheimes basierte im Kern immer auf einer echten Nachfrage und Menschen, die engagiert und freiwillig diese abdecken, oft als Trägerverein oder Stiftung organisiert.
Dieser «marktwirtschaftlich Kern» wird der Kantonsrat montags zerstören.
Ein grosser Kuchen zum Verteilen
Doch zuerst nochmals zurück zu den Finanzen: Es geht um viel Geld. Um rund 300 Millionen Franken pro Jahr. Diese werden vor allem für die Löhne, die täglichen Lebenskosten der rund 2’400 in Heimen untergebrachten Kinder und Jugendlichen und für die Liegenschaften gebraucht. CHF 125’000 Franken kostet somit ein Heimplatz durchschnittlich. Für viele Eltern zu viel, um es bezahlen zu können.
Deshalb ist im kurzen Gesetz über die «Jugendheime und Pflegekinderfürsorge» von 1962 die Beteiligung des Kantons geregelt. Daraus ergab sich die Praxis, dass Eltern zusammen mit den Gemeinden die nach Art des Heimes (Schulheim, Erziehungsheim, Justizvollzug) unterschiedlich hoch festgelegten Versorgertaxen bezahlten (rund 65 Prozent der Gesamtkosten) und der Kanton den Rest (35 Prozent). Ein bisschen Bundesgelder und IV-Renten sind auch im Topf – und da die Versorgertaxen alle paar Jahre festgelegt wurden, da Defizite der Heime manchmal höher und manchmal geringer ausfallen, variierte die Verteilung oft. Es ging nicht ohne Anträge und Diskussionen.
Keine Verluderung
Missbrauch und Verwahrlosung sind eine Gefahr, wenn Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, nicht beaufsichtigt werden, besonders (aber nicht nur) wenn es fremde Kinder und Jugendliche sind. Die Aufsicht über erzieherische, sittliche und hygienische Vorgaben liegt ebenfalls beim Kanton. Samt dem Recht, Einrichtungen, bei denen Missstände festgestellt werden, zu schliessen. Das ist gut. Aus dem Kanton Zürich sind kaum Fälle von Verluderung der Zustände in einem Heim bekannt, die Heime sind sensibel und treffen Vorkehrungen, damit Missbrauchsfälle selten werden. Die Aufsicht funktioniert. Auch wenn unterschiedliche Gesetze dahinter stehen: Bei Pflegeheimen das Gesundheitsgesetz, bei Schulheimen das Volksschulgesetz, bei den Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter das Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz. Auch letztere beiden passt der Kantonsrat an.
Bewilligungspflicht
Der juristisch zwingende Grund für die Anpassung ist gleichzeitig der Kleinste und er kommt von oben: Die eidgenössische Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) macht betreffend Bewilligung von Heimen Vorgaben: Der Kanton darf Heime nicht nur beaufsichtigen und notfalls schliessen, er muss sie stattdessen bewilligen. Das wäre, nüchtern gesehen, fast dasselbe, einfach umgekehrt ausgedrückt. Doch die nüchterne Betrachtungsweise hat sich weder beim Regierungsrat noch in der Kommission für Bildung und Kultur (KBIK), die das neue Gesetz für den Kantonsrat vorbereitete, durchgesetzt.
Im Gegenteil. Die notwendige kleine Änderung wurde als Anlass für Wunschrealisierungen genommen:
- Einige Gemeinden wollen Kosten abwälzen: Dank der neuen PAVO entscheidet die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) über die Betreuung eines Kindes, wenn das Kindswohl gefährdet ist. Damit haben die Sozialbehörden der Gemeinden, welche den höchsten Anteil der Versorgungstaxen der Eltern bezahlen, Einfluss verloren. Oft winken sie KESB-Beschlüsse durch, statt sie kritisch zu hinterfragen. Also wollen viele Gemeinden auch weniger bezahlen.
- Sicherheit für Heime: Die Finanzierung der Heime funktioniert heute, doch schwankender Bedarf an Plätzen bedeutet ein unbequemes Risiko. So ist Markt halt. Fixe Leistungsvereinbarungen wären bequemer und böten sichere Arbeitsplätze.
- Administrative Vereinfachung: Die kantonale Mitfinanzierung der Heime bedeutet manchmal die Koordination von drei Ämtern (Jugend- und Berufsberatung, Volksschulamt, Justizvollzug) zur Prüfung von Gesuchen. Und die Verwaltung klagt über den Aufwand für Jugendliche, die ausserhalb des Kantons betreut werden, diese managt sie, weil dazu eine interkantonale Vereinbarung existiert.
- Aber vor allem: Trotz Aufsicht und Mitfinanzierung fehlt dem Kanton die Macht zum Steuern. Denn noch darf jeder, der die qualitativen Anforderungen erfüllt, ein Heim gründen und die KESB und die Gemeinden können Fälle zuweisen.
Weniger bezahlen für Gemeinden, mehr Sicherheit für Heime, Vereinfachung und Steuerung für den Kanton: Das tönt auf den ersten Blick vernünftig. Wäre da nicht der zweite Blick auf die dafür vorgesehenen Massnahmen:
- Zentrale Gesamtplanung: Die Bildungsdirektion plant neu die Heimversorgung und muss neue Heime nur dann bewilligen, wenn sie in die Gesamtplanung passen. Nur dann erhält ein Heim eine Leistungsvereinbarung und somit Arbeit.
- Staatliche Preisbildung: Die Tarife der Heime werden in den Leistungsvereinbarungen kantonal festgelegt.
- Heime mit Leistungsvereinbarung müssen sich nicht mehr um Einkünfte und daher um Angebotsoptimierung kümmern.
- Kostenverteilung an alle: Die Gemeinden bezahlen nicht mehrihre Fälle, sondern ca. CHF 10.— pro Kopf der Bevölkerung. Diesen Betrag liefern sie dem Kanton ab, welcher ihn an die Heime verteilt. Wenn ein weniger optimales Heim gewählt wird oder eine Heimeinweisung sogar verhindert wird: Es kostet immer gleich viel.
- Bürokratie: Die kantonale Verwaltung spricht zu jedem einzelnen Fall nach Antrag der KESB und Beschluss der Gemeinde eine eigene Kostengutsprache (neu drei statt zwei Behörden beschliessen jeden Fall). Auch werden die Bewilligungsvoraussetzungen komplexer.
Kommen Ihnen diese fünf Punkte bekannt vor? Richtig: Es sind die Charakteristiken der Planwirtschaft. Und damit zurück zum Anfang des Artikels: Bei Kinder- und Jugendheimen wird schlicht die bedarfsgerecht-selbstmotivierte Aufgabenerfüllung abgeschafft. Kommen wirtschaftliche schwierigere Zeiten auf uns zu, wird es für Kinder- und Jugendliche gefährlich.
Einfache und schlanke Alternative, falls FDP zur Raison kommt
Die SVP Fraktion hat Anträge gestellt, mit denen das juristisch Notwenige erfüllt wird. Damit die Kosten für den Kanton nicht ausufern und die Abläufe administrativ einfacher werden, schlagen wir vor, statt der bisherigen Subventionierung den kantonalen Beitrag pro Fall auszurichten. Im Übrigen lassen wir die Situation, wie sie ist: Keine Gesamtplanung, keine Kostenabwälzung an die Allgemeinheit, keine staatliche Preisbildung. Es wundert nicht, dass mit den SVP-Anträgen das Gesetz erheblich kürzer wird, als die Version der Regierung.
Was hingegen wundert, ist, dass die Marktwirtschaft von jenen, die sich selbst liberal nennen (FDP, GLP) ohne Not geopfert wird. Es scheint fast, als hätten sie die falschen Parteimitglieder in die vorberatende Kommission abgeordnet, jene, die dem 300-Millionen-Kuchen nahestehen, statt Marktwirtschaft verstehen. Mein Wunsch wäre, dass die beiden Parteien noch zur Raison kommen!