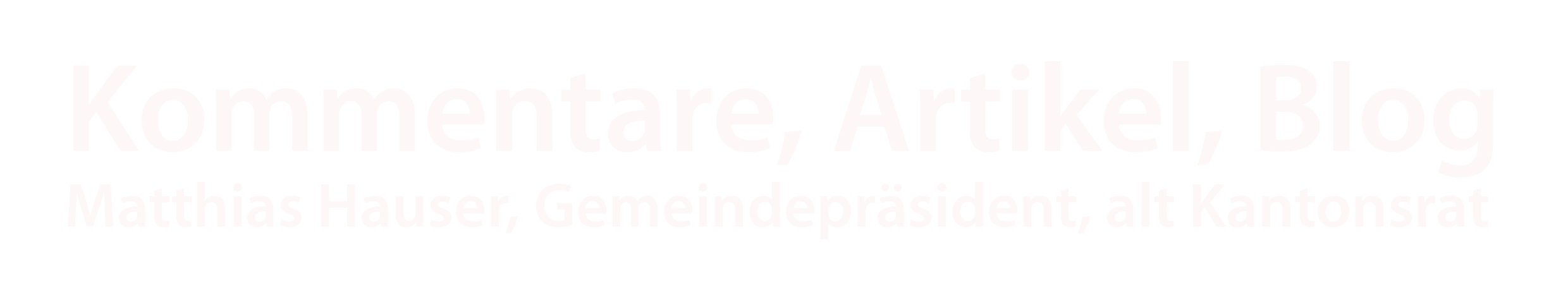Ein super Vortrag von Josef Kraus, damals Präsident des Deutschen Lehrerverbandes (DL)
Egalitäre Schulpolitik und kuschelige Schulpädagogik sind ein Friedhof, auf dem be- ständig Auferstehung gefeiert wird. Dies gilt vor allem seit 2001, als die erste PISA- Hysterie-Tsunami-Welle über unsere Länder hinweggeschwappte. Es war übrigens eine Hysterie-Woge, die – wie sollte es anders sein – sauertöpfisch, konformistisch- spiessig und intellektuell genügsam daherkam.
Sie merken, geschätzte Zuhörer: Mit einer Festrede wird es heute nichts.
Hoffentlich gibt es deswegen jetzt keine diplomatischen Verwicklungen. Aber mir scheint, manche der progressiven und ewig-morgigen Schlaumeier in unseren Län- dern sind wieder einmal dabei, in die stets gleichen Fall-Gruben zu fallen:
- in die Egalitäts-Falle, die Ideologie nämlich, dass alle Menschen, Strukturen, Werte und Inhalte gleich bzw. gleich gültig seien;
- in die Machbarkeits-Falle, den Wahn, jeder könne zu allem begabt werden;
- in die Falle der Erleichterungs- und Gefälligkeitspädagogik;
- in die Quoten-Falle, die planwirtschaftliche Vermessenheit nämlich, es müsstenmöglichst viele Menschen mit dem Matur-Zeugnis ausgestattet werden.
Ein schulpolitisches Bermuda-Viereck nenne ich das, in dem Begabung, Qualität und Leistung zu verschwinden drohen.
Nun will ich skizzieren, wie aus meiner Sicht die Schule aussehen könnte, die unsere Kinder und unsere Länder brauchen. Acht Anmerkungen!
1.
Wie in vielen anderen Bereichen muss Freiheit auch in Sachen Bildung Vorrang vor Gleichheit haben.
Ich sage dies mit Bedacht so, denn ich befürchte, dass wir schulisch einseitig auf dem Trip in Richtung Gleichheit bzw. Gleichmacherei sind. (Mancher spricht gar von einer „Gleichheitskrankheit“).
Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an Alexis de Toqueville (1835) und des- sen warnendes Wort: Freiheit erliege gern der Gleichheit, weil Freiheit mit Opfern erkauft werden müsse und weil Gleichheit ihre Genüsse von selbst darbiete. Am En- de sei den Menschen die Gleichheit in Knechtschaft lieber als die Ungleichheit in der Freiheit.
Das Spannungsverhältnis von Gleichheit und Freiheit ist gleichwohl nicht aufheb- bar: Sind die Menschen frei, dann wollen sie gleich sein; und sind die gleich, so wol- len sie frei sein. Das geht nicht zusammen. Deshalb gilt nach wie vor, was Goethe
meinte: „Gesetzgeber oder Revolutionäre, die Gleichheit und Freiheit zugleich ver- sprechen, sind Phantasten oder Scharlatane“.
Freiheit oder Gleichheit? Bezogen auf Schulbildung lautet die Frage: Soll ein Schul- wesen am Prinzip Freiheit oder am Prinzip Gleichheit orientiert sein?
Hier gebe ich dem Prinzip Freiheit eindeutig den Vorrang, denn Gleichheit total wäre der Tod von Individualität. Und haben wir uns erst einmal der Gleichheit verschrie- ben, so fangen wir, Unterschiede abzuhobeln.
Die „conditio humana“ kennt aber keine Gleichheit. Menschen kommen nun einmal unterschiedlich auf die Welt. Gottlob! Alles andere wäre Langeweile pur!
An der Unterschiedlichkeit und an der Vielfalt von Menschen ändern keine noch so moralisierende egalitäre Zivilreligion, kein Schulsystem und auch kein noch so ges- talteter Unterricht etwas. Das ist nun einmal das unüberwindbare Dilemma des pä- dagogischen Egalitarismus:
- Egalitäre Schulpolitik erzielt vermeintliche Gleichheit allenfalls durch Absen- kung des Anspruchsniveaus. Wer aber die Ansprüche senkt, der bindet ge- rade die junge Menschen aus schwierigeren Milieus in ihren „restringierten Codes“ fest.
- Egalitäre Schulpolitik verfestigt sogar Unterschiede, weil die Klügeren und diejenigen aus entsprechenden Elternhäusern sich ihre „Gehirnnahrung“ dann woanders holen.
- Selbst ein hochindividualisierender Unterricht zementiert Unterschiede. Die Lernforscherin E. Stern (MPIB, seit 2006 ETH Zürich) schreibt dazu (ZEIT, 28.7.2005): „Je besser der Unterricht ist, je mehr wir die Schüler ihren indivi- duellen Möglichkeiten entsprechend fördern, desto mehr schlagen die Gene durch – und die sind nun einmal ungleich verteilt.“
Was heisst das praktisch? Beim Start in die Bildungslaufbahn sollten – abgesehen von den Genen – alle die gleichen Chancen haben, gleiche Zielchancen kann es a- ber nicht geben. So äussert sich auch der Begabungsforscher Christopher Jencks, dessen Klassiker von 1972 „Inequality“ betitelt ist (und der in Deutschland im Jahr 1973 mit dem Titel „Chancengleichheit“, nicht „Chancen-Ungleichheit“ auf den Markt kam).
Ich füge hinzu: Gleiche Startchancen – ja! Aber Chancen sind keine Garantien, zu Erfolgsaussichten können sie erst durch eigene Anstrengung werden.
Gleichmacherei würde solche Anstrengungsbereitschaft gefährden, sie würde auch Eigenverantwortung und Eigeninitiative bremsen. Gleichmacherei wäre auch nur ge- fühlte Gerechtigkeit nach dem Motto: Was nicht alle können, darf keiner können. Das kann es nicht sein.
2.
Wir brauchen keine Strukturdebatten. Deshalb ist die Alternative zum geglie- derten Schulwesen nicht die Gesamtschule, sondern ein verbessertes gegliedertes Schulwesen mit noch mehr individueller Förderung.
Die Tatsache, dass bei PISA mit Finnland ein Gesamtschulland gut abgeschnitten hat, sagt wenig aus. Immerhin sind es auch Gesamtschulländer, die am Ende der PISA-Rankings stehen; siehe Brasilien, Mexiko!
Gesamtschule ist in Deutschland hat ansonsten Jahrzehnte durchschlagender Er- folglosigkeit hinter sich. Aber so ist nun einmal der Mensch: Was der Bauch nicht will, lässt der Kopf nicht rein! Dennoch zwei Belege von vielen:
Befund a: Aus PISA 2000 und 2003 wissen wir, dass die einzigen deutschen Län- der, die international im PISA-Konzert vorne mithalten konnten, Sachsen, Baden- Württemberg und Bayern waren. Diese drei erreichten ohne Gesamtschulen ein Er-gebnis, das weit über dem von Gesamtschulbefürwortern hochgerühmten Schweden bzw. im Falle Bayerns ganz nahe am finnischen Ergebnis rangierte.
Befund b: Aufschlussreich ist die Studie „Bildungsverläufe und psychosoziale Ent- wicklung im Jugendalter“ (BIJU, 1991 bis 1996) des Max-Planck-Instituts für Bil- dungsforschung (MPIB). Für NRW wird festgehalten: Am Ende der 10. Klasse liegen Gesamtschüler im Vergleich mit Realschülern um zwei, im Vergleich mit Gymnasias- ten um drei Jahre zurück! Zugleich wird diagnostiziert, dass die Gesamtschüler hin- sichtlich sozialen Lernens nicht mit den Schülern der anderen Schulformen mithalten können.
Wenn Gesamtschul-Kräfte trotzdem von Gesamtschule schwärmen, weil diese an- geblich soziale Selektion vermeide, dann verschweigen sie, dass soziale Selektion nach dem Geldbeutel der Eltern vor allem in Ländern mit einem Gesamtschulsystem stattfindet: In England, Frankreich, Japan und den USA laufen die Eltern der öffentli- chen Gesamtschule davon, wenn sie es sich leisten können, ihr Kind für jährlich 15.000 bis 30.000 Euro (also 25.000 bis 50.000 SFr) in Privatschulen zu schicken.
Und: Die durchschlagende Erfolglosigkeit deutscher Gesamtschule ist den Steuer- zahler teuer zu stehen gekommen. Wir wissen aus NRW und aus Hamburg, dass Gesamtschule um rund 25 bis 30 Prozent teurer ist als Schule des gegliederten Schulwesens (und trotzdem erheblich weniger leistet).
Unsere Schulvisionäre leiden gleichwohl progredient an einem real existierenden Knick in der Optik. Immer noch pilgern sie in den hohen Norden. Warum, das weiß ich nicht, denn der sog. PISA-Sieger Finnland kann aus mehreren Gründen kein Maßstab sein. Dort hat man Rahmenbedingungen, die wahrlich paradiesisch sind: durchschnittlich 120 Schüler pro Schule und 18 Schüler pro Klasse, extra Förderleh- rer für die Schwächeren und nur 1,2 Prozent Migrantenquote. Trotzdem gibt es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) kaum ein Land, in dem Schüler zu unzufrieden mit Schule sind wie dort. Und es gibt kaum ein Land, in dem unter Jugendlichen die Arbeitslosenquote, die Alkoholikerrate und die Suizidantenrate so hoch ist wie in Finnland.
Zwischenresümee: Wir fahren mit unserem differenzierten Schulwesen nicht schlecht. Wir sollten uns deshalb auch nicht blenden lassen von den angeblichen Segnungen eines zweigliedrigen Schulwesens. Zweigliedrigkeit ist nämlich ein bisschen Differenzierung und ein bisschen Integration – also zweimal ein bisschen schwanger, aber nicht wirklich schwanger. Aber ernsthaft: Wer eine Schulform (etwa die Realschule oder die Bezirksschule) kappt und in eine andere Schulform hineinpfropft, der hat zwar eine skandalöserweise diskriminierte Schulform abgeschafft, aber nicht deren Schüler, nicht deren Förderbedürfnisse und deren Probleme.
3.
Es gibt keinen Grund, die Grundschule/Primarschule zu verlängern.
Was den Zeitpunkt der Differenzierung betrifft, so sagen die Fakten und alle nam- haften Studien für Deutschland eindeutig aus: Sechsjährige Grundschule oder integ- rierte Orientierungsstufe bringt nichts – weder kognitiv noch sozial.
Man hätte es immer schon wissen können. Selbst einer der frühen Säulenheiligen der Gesamtschulgedankens in Deutschland, Heinrich Roth, schrieb 1968: „Die Denkbegabung und das Denkbedürfnis bricht im zehnten/elften Lebensjahr in so ver- schiedenen Stärken durch, dass die Unterschiede … das Auffälligste sind, was man in diesem Alter betrachten kann. Die Unterschiede werden in diesem Alter so krass, dass eine Trennung nach dem Grad der Begabung in irgendeiner Form unerlässlich ist … Hier hilft keine romantisch-pädagogische Verbrämung! … Im Interesse der Höchstausbildung aller Begabungsgrade kommen wir um die Trennung nach dem Grad der Begabung im zehnten/elften Lebensjahr nicht herum.“
Prof. Kurt Hellers (LMU München) Fazit lautet: „Eine Verlängerung der vierjährigen Grundschule würde keine erkennbaren Vorteile, wohl aber mit Sicherheit Nachteile für viele Grundschüler mit sich bringen. Diese betreffen nicht nur Leistungsaspekte, sondern tangieren die gesamte Persönlichkeitsentwicklung ….“
Peter Roeders (MPIB Berlin) Fazit lautet: „Die Leistungen nach sechsjähriger Grundschule liegen erheblich unter denen von Schülern, die den Wechsel aufs Gym- nasium bereits nach der 4. Grundschulklasse vollzogen haben. Für Englisch und Ma- thematik beträgt der Unterschied etwa eine Standardabweichung.“ 1997 schrieb er: „Die Leistungen nach sechsjähriger Grundschule liegen erheblich unter denen von Schülern, die den Wechsel aufs Gymnasium bereits nach der 4. Grundschulklasse vollzogen haben.“
Von besonderer Eindeutigkeit ist die Studie mit dem Titel ELEMENT von Prof. Rai- ner Lehmann (Humboldt-Universität Berlin) vom April 2008. Im Rahmen dieser Stu- die wurden 4.700 Berliner Schüler getestet (3.000 Grundschüler und 1.700 Schüler, die bereits mit der 5. Klasse ein Gymnasium besuchten). Die zentralen Ergebnisse dieser Studie lauten:
- Kinder werden durch eine sechsjährige Grundschule gebremst: Rückstand am Ende der 6. Grundschulklasse im Lesen eineinhalb Jahre, in Mathematik und Englisch zwei Jahre (im Vergleich mit Schülern, die nach der 4. Klasse in eine weiterführende Schule gehen können)
- Zwei Extrajahre bringen keinerlei Abbau sozialer Disparitäten. Die soziale Schere öffnet sich sogar noch weiter.
- Vor allem stärkere Schüler werden zu wenig gefördert.
4.
Wir fahren nicht schlecht mit unseren Strukturen beruflicher Bildung
Mit dieser Aussage wende ich mich gegen eine OECD und ihre Claqueure, die mei- nen, uns deutschsprachigen Ländern vorhalten zu müssen, wir würden eine zu ge- ringe Quote an Studierenden und Akademikern produzieren. Dazu sage ich: Ein sol- ches Quotendenken verwechselt Quantität und Qualität. Ausserdem beginnt der Mensch nicht mit der Matura.
Dabei taugt dieses planwirtschaftliche Büro für Bildungsideologie in Paris nicht einmal zum glaubwürdigen Erbsenzähler. Da war ja die Planwirtschaft der DDR fast noch seriöser. Zum Beispiel sind viele der OECD-Aussagen zur Akademikerquote und zur sozialen Durchlässigkeit eines Bildungswesens schlicht und einfach statisti- sche Artefakte:
- In Finnland und in den USA etwa gilt die Ausbildung zur Krankenschwester, zum Krankenpfleger oder zur Kindergartenerzieherin als Hochschulausbildung. Da kann man leicht auf hohe Akademikerquoten kommen. Zugleich halte ich fest: Viele unserer Schul- und Berufsabschlüsse unterhalb der formal-akademischen Schwelle haben den gleichen Rang wie andernorts Hochschulabschlüsse.
- Auch die angebliche soziale Durchlässigkeit des Bildungswesens anderer Staa- ten ist oft ein statistisches Artefakt: Wenn in Finnland die Tochter eines Industrie- arbeiters Krankenschwester wird, dann gilt sie als Paradebeispiel für die soziale Durchlässigkeit des dortigen Bildungswesens. Wenn in Deutschland die Tochter eines VW-Facharbeiters Krankenschwester wird, gilt sie als angeblich schreckli- ches Beispiel für die mangelnde soziale Durchlässigkeit unseres Bildungswesens.
Interessant auch: Dort wo man in Europa die niedrigsten Abiturienten/Maturanten- Quoten hat, hat man zugleich die besten Wirtschaftsdaten; nämlich in Österreich, in der Schweiz sowie in Baden-Württemberg und Bayern.
Im übrigen gilt: In Sachen Abiturientenquote verhalten sich Quantität und Qualität reziprok! Ein Abitur / eine Matura „light“ ist noch lange kein Attest für Studierfähigkeit.
Was soll dieses dümmliche Quoten-Wettrüsten also?
5. Eine gerechte Schule kann nur eine Schule der Leistung sein.
Indes tut eine um sich greifende Spass-, Erleichterungs- und Gefälligkeitspädagogik so, als ginge alles ohne Anstrengung. Leistung und Begabung wurden schier zu Missgunst-Vokabeln. Da ist im Zusammenhang mit Schule in übler Weise immer wie- der die Rede von „Leistungsstress“, „Leistungsdruck“, „Leistungsterror“.
Mittelbar finden diese Diskriminierungen von Leistung in der politisch bzw. administ- rativ verordneten Schulpraxis mancher deutscher Länder ihren Niederschlag. Ich nenne:
- die Liberalisierungen in der Notengebung, gar deren Abschaffung,
- die Egalisierung der Schulfächer und ihrer Inhalte,
- die Geringschätzung konkreten Wissens,
- die Vernachlässigung solider muttersprachlicher Bildung,
- der Verzicht auf Auswendiglernen und Kopfrechnen.
Wer aber das Leistungsprinzip solchermassen bereits in der Schule untergräbt, setzt zugleich eines der revolutionärsten demokratischen Prinzipien ausser Kraft. In un- freien Gesellschaften sind Geldbeutel, Geburtsadel, Gesinnung, Geschlecht oder dergleichen Allokationskriterien – Kriterien zur Positionierung eines Menschen in der Gesellschaft. Freie Gesellschaften haben an deren Stelle das Kriterium Leistung vor den Erfolg und den Aufstieg gesetzt. Ein revolutionärer Fortschritt und zudem die grosse Chance zur Emanzipation für jeden Einzelnen!
Und ein weiteres: Auch Sozialstaatlichkeit ist nur mit dem Leistungsprinzip mach- bar. Ein simpler Beweis hierfür ist die Tatsache, dass 20 Prozent der besonders Leis- tungsfähigen 70 Prozent des Steueraufkommens leisten. Deshalb kann das Sozial- prinzip auch nicht über das Leistungsprinzip gestellt werden. Das Sozialstaatsprinzip ist allerdings ein dem Leistungsprinzip immanentes Korrektiv.
All dies gilt zumal für Eliten, ohne die kein Gemeinwesen auskommt. Hier müssen wir vor allem aufpassen, dass uns vor lauter Pathos um den sozialen Ausgleich via Schulwesen nicht die Förderung von gesamtgesellschaftlich notwendigen Leistungs- und Verantwortungseliten abhanden kommt.
Verschiedenheit ist jedenfalls keine Ungerechtigkeit! Vielmehr ist nichts so un- gerecht wie die gleiche Behandlung Ungleicher! Nur in totalitären Organisationen gibt es die eine, zeitlose Gerechtigkeit als Ausdruck einer – gleichfalls totalitären – Glücksverheissung.
Halten wir fest: Leistungsfeindlichkeit ist ein Anschlag auf das Grundrecht der freien Persönlichkeitsentfaltung.
Mit „Selektion“ in dem von gewissen Leuten intendierten Sinn hat dies rein gar nichts zu tun. „Selektion“ ist leider zum demagogischen Kampfbegriff geworden. Dieser Begriff soll ganz offenbar gezielt dunkle Kapitel deutscher Geschichte assoziieren lassen. Ich halte dies für schäbig, denn hier wird ein millionenfaches Leid der Opfer des NS-Terrors für billige Zwecke instrumentalisiert.
Das Prinzip Leistung und das Prinzip Auslese sind nun einmal die beiden Seiten ein und derselben Medaille. Das ist in allen Ländern der Welt so.
Zudem ist Auslese eine notwendige Voraussetzung für individuelle Förderung von Kindern. Die anti-thetische Formel „Fördern statt Auslese“ ist grundfalsch. Es muss heissen: Fördern durch Differenzierung! Und es muss heissen: Fordern und Fördern, aber es geht nicht, die einen zu fördern und die anderen zu bremsen!
6. Qualitätsorientierte Schule ist eine Schule der konkreten Wissensinhalte.
Seit einiger Zeit wird der fachlich fundierte Schulunterricht von quasi-modernen Pä- dagogen in diskreditierender Absicht in die Nähe von „Paukunterricht“, „Stoffhuberei“ und „Schubladendenken“ gerückt. Stattdessen – so heisst es – seien die Zauberfor- meln der „Schlüsselqualifikationen“ und des „fachübergreifenden Lernens“ angesagt. Dann, so die Heilserwartung, würde sich das ganze Füllhorn an Methoden-, Basis-,
Horizontal-, Sozial- und Handlungskompetenzen wie von selbst über die Schüler er- giessen. Glaubt man!
Wir erleben es aber tagtäglich, was herauskommt, wenn es nur um inhaltsleere Kompetenzen, nicht mehr aber um konkretes Wissen geht. Vor allem im öffentlichen Bereich scheint die wichtigste Kompetenz für die Eroberung herausgehobener Posi- tionen eine ganz bestimmte Kompetenz zu sein, nämlich die Inkompetenzkompensi- onskompetenz. (Begriff von Odo Marquardt). Und das Ganze nennt man Wissensge- sellschaft! Wahrlich ein Euphemismus!
Es gibt aber keine Bildung ohne Inhalte. Schüler qua „Methodentraining“ nur im Gebrauch des Textmarkers zu schulen, das ist Firlefanz. Wir brauchen wieder einen Primat der Inhalte vor den Methoden. Die blanke Forderung nach einer blossen, in- haltsleeren Vermittlung von Kompetenzen wäre wie der Vorschlag, ohne Zutaten zu kochen (K. P. Liessmann).
Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich bin für vernetztes, fachübergreifendes Denken. Dieses setzt aber solide fachliche Grundlagen voraus, sonst wird daraus eine Vernetzung von Nullmengen.
Es ist also eine Renaissance des konkreten Wissen angesagt. Auch aus demokra- tie-politischen Gründen. Denn es gilt: Wer nichts weiß, muss alles glauben. Wer aber alles glauben muss, der wäre kein mündiger Bürger.
Wir brauchen also eine Debatte um Inhalte und um den Kanon-Gedanken. Wir brau- chen einen Grundbestand an Literaturkenntnis, einen Grundbestand an Wissen in den Fächern Kunst und Musik ….. Dies ist auch deshalb wichtig, weil kanonisches Wissen Verlässlichkeit bietet, weil kanonisches Wissen eine unverzichtbare Kommu- nikationsgrundlage ist und weil ein zu schmales Wissen (unter aller „Kanone“) Kom- munikation erst gar nicht entstehen lässt!
7. Es gibt keine Bildungsoffensive ohne häusliche Erziehungsoffensive!
In den letzten Jahren greifen mehr und mehr omnipotente Vorstellungen von Schule um sich. Die fachliche Bildungs- und Unterrichtsarbeit wird damit an den Rand ge- drängt; Schule soll offenbar zur hypertrophen Schule werden.
Davor muss Schule bewahrt werden. Denn Folge dieser Omnipotenzerwartungen ist, dass unsere Schulen immer noch mehr Bindestrich-Erziehungen bekommen: zum Beispiel Umwelt-, Gesundheits-, Konsum-, Freizeit-, Medien-, Anti-Gewalt-Erziehung u.a.m. Und diese Inflation hat gleichfalls Folgen: nämlich immer mehr Delegation el- terlicher Erziehung an die Schule und damit einhergehend eine permanente Überfor- derung der Schule.
Leider ist Erziehung zum Delegationsgeschäft geworden; sie findet über „outsour- cing“ statt. Wenn aber der Anteil der Eltern, die trotz immer grösserer eigener Freizeit bei immer weniger Kindern ureigene Aufgaben an die Schule delegieren oder die aus Gründen der Bequemlichkeit auf erzieherische Einflussnahme verzichten, immer grösser wird, dann hat die Schule keine Chance, die Bildungsqualität zu verbessern.
Schulerfolg kommt schliesslich nicht nur aus dem Klassenzimmer, sondern er braucht eine entsprechende familiäre Atmosphäre. Wenn die häusliche Vorbereitung der Schüler nicht klappt, dann klappt es in der Schule nicht. So einfach ist das.
Mit anderen Worten: In Sachen Bildung gibt es eine Bringschuld des Gemeinwesens, es gibt aber auch eine Holschuld, nämlich die Verpflichtung der Familie und ihrer Kinder, ein vom Gemeinwesen vorgehaltenes und steuerfinanziertes Angebot abzu- holen!
Hören wir also auf, für alles, was nicht klappt, den Staat und das „System“ verant- wortlich zu machen. Nicht wenige, die dies hören, nehmen dies sonst zum Anlass, um es sich bequem zu machen. Der Staat ist schliesslich nur Ermöglicher von Glück, aber nicht Garant von Glück!
Eine Offensive elterlicher Erziehung ist also überfällig. Kinder brauchen (wieder) Vor- bilder – erwachse, keine nur postadoleszenten. Wer nämlich selbst vorzugsweise erdnussmampfend mit einer „Blechsemmel“ (Bierdose) vor der Glotze sitzt, kann schlecht ins Kinderzimmer rufen: Nun lies doch mal ein Buch!
8. Wir brauchen Bildung statt PISA!
Es ist ein ärmliches Verständnis zu glauben, PISA habe mit Bildung zu tun. Nein: PISA misst nur einen kleinen Sektor aus dem Lerngeschehen. Böse Zungen be- haupten gar, PISA messe nichts anderes als die Fertigkeit, den PISA-Test auszufül- len. Ausgeblendet bleiben bei PISA jedenfalls weite Bereiche schulischer Bildung: Fremdsprachen, Literatur, Religion/Ethik, Geschichte, Kunst, Musik, Sport.
Vor diesem Hintergrund PISA zum Evangelium für das Bildungswesen hochstilisie- ren zu wollen, das geht völlig daneben. Und wer meint, Bildung sei das, was PISA misst, der unterliegt dem operationalistisch-reduktionistischen Verständnis, das einst einer simplen Definition von „Intelligenz“ zugrunde lag. In den 70er Jahren konnte man sich nämlich nicht darauf einigen, wie Intelligenz zu definieren sei. An die hun- dert verschiedene Definitionen gab es dann. Die einzig konsensfähige Definition war am Ende: „Intelligenz ist das, was der Intelligenz-Test misst.“ (Ich füge boshaft dazu: Die Intelligenz und vor allem die Intelligenzia haben sich von dieser Definition bis zum heutigen Tag nicht erholt.)
Bildung ist jedenfalls erheblich mehr als das, was PISA misst. Wir brauchen deshalb eine Schule jenseits von PISA. Es geht um Wägen und nicht um Zählen, Zahlen, Statistiken, Tabellen, Histogramme und Ranking-Skalen.
Wir müssen uns wieder auf den Eigenwert des Nicht-Mess-baren besinnen. Wir sind mit dem Grundsatz, dass unsere Schulen Allgemeinbildung und nicht nur Ver- wert- und Messbares leisten sollen, gut gefahren, und wir sollten uns daran erinnern. Es ist nun einmal vieles in Sachen Bildung nicht messbar. Wer solches glaubt, der hat ein erbärmlich mechanistisches Menschenbild.
Ausserdem gilt: Vom Pulsmessen allein wird man nicht gesund – es sei denn man ist ein Hypochonder! Und (so Karl Kraus): Eine der schlimmsten Krankheiten ist die Diagnose!
Wenn es um Bildung geht, dann müssen wir ausserdem auf den Eigenwert des Nicht-Ökonomischen setzen!
Vor diesem Hintergrund sind mir gewisse Management-Sprüche im Zusammenhang mit Schule ein Dorn im Auge – Sprüche wie Marketing, Benchmarking, Just-in-time- Knowledge, Download-Wissen usw. Da fehlt eigentlich nur noch ein „last-minute- learning“!
Ernsthaft wieder: Bildung kann nicht gedeihen am Pflock der Ökonomie. Schule kann auch nicht nach Rentabilitäts-Gesichtspunkten geführt werden. In einem Un- ternehmen – das ist klar – muss ich alles wegrationalisieren, was sich nicht lohnt. Alltag in Schule aber ist es, dass sich hier bei einem Teil der Schüler nichts zu loh- nen scheint. Hier nach Rentabilitätsgesichtspunkten zu arbeiten, das liefe aber auf eine un-soziale Vorstellung von Schule hinaus.
Legen wir also bitte den flachen Bildungsökonomismus beiseite! Wir brauchen eine Re-Kultivierung unserer Gesellschaft und unserer Bildungseinrichtungen. Wir brau- chen in Sachen Bildung wieder mehr Ernsthaftigkeit sowie geistige und mentale Fun- damente statt hyperaktiver Veränderungsrhetorik.
Man spürt: Orientierung lässt sich selbst in einer globalisierten Cyber-Welt nicht von irgendeiner Homepage „downloaden“. Solche Orientierung liefert nur die Partizipation am kulturellen Gedächtnis. Identität kommt nicht aus „skills“, sondern nur aus der „Er-Innerung“ des historisch-kulturellen Erbes. Das ist übrigens der Grund, warum totalitäre Systeme zur Proklamation einer ewigen Gegenwart neigen. Er-Innern ist damit Chance des Widerstands gegen Indoktrination.
Eine Bildung der blossen „Daseinsgefrässigkeit“ (Arnold Gehlen) wäre eine Verwei- gerung von Orientierung. Zeichen von Ungebildetsein wäre es, sich einem Absolu- tismus der Gegenwart zu überlassen. Deshalb stellt Josef Pieper (+1997) zu Recht fest: „Dem Menschen ist es mehr vonnöten, erinnert als belehrt zu werden. Er kommt nicht allein dadurch zu Schaden, dass er das Hinzu-Lernen versäumt, sondern auch dadurch, dass er etwas Unentbehrliches vergisst und verliert.“
Zum Schluss
Wir sollten uns endlich von dem Aberglauben verabschieden, der zu wissen meint, jede Veränderung sei per se eine Verbesserung. Es gilt auch hier die die Beweis- lastregel. Diese besagt: Der Reformer hat die Beweispflicht, nicht derjenige, das das Erfolgreiche behutsam weiterentwickeln möchte.
Es geht nicht um „alt“ oder „neu“, sondern es geht um „falsch“ und um „richtig“. Das Alte, das Bewährte ist nicht automatisch falsch, und das Neue nicht per se gut, bes- ser. Jedenfalls gilt für „neue“, für „progressive“ Schulpolitik, was Gotthold E. Les- sing als Rezensent so manchem Stück ins Stammbuch schrieb: Es enthält Neues und Gutes; aber das Gute ist nicht neu, und das Neue ist nicht gut.
Alles in allem brauchen wir anstelle des üblichen Reform-Mantras eine rationale und realistische Schulpolitik – eine Schulpolitik, die frei ist von der anmassenden Vision einer endgültigen Ausgereiftheit ihrer Konzepte. Eine solche Politik sollte eine ge- sunde Skepsis pflegen
- gegen blinden Optimismus,
- gegen den Dogmatismus pädagogischer Scharlatane,
- gegen die Vorstellung, Bildung und Erziehung seinen Glücksache (Kleeblatt-Glückssache!).
Solche rationale Schulpolitik muss werben
- für die Bereitschaft, die Unterschiedlichkeit der Menschen zu akzeptieren;
- für die Einsicht, dass Unterschiede und Vielfalt Bereicherung bedeuten;
- für die Überzeugung, dass Gleiches gleich und Unterschiedliches unterschiedlich behandelt werden muss.
Andernfalls stolpert Schulpolitik von einer Enttäuschung zur nächsten.Jedenfalls wünsche ich Ihnen, uns allen viel Erfolg im Streiten gegen fade, integrierte Einfalt und für lebendige, differenzierte Vielfalt.