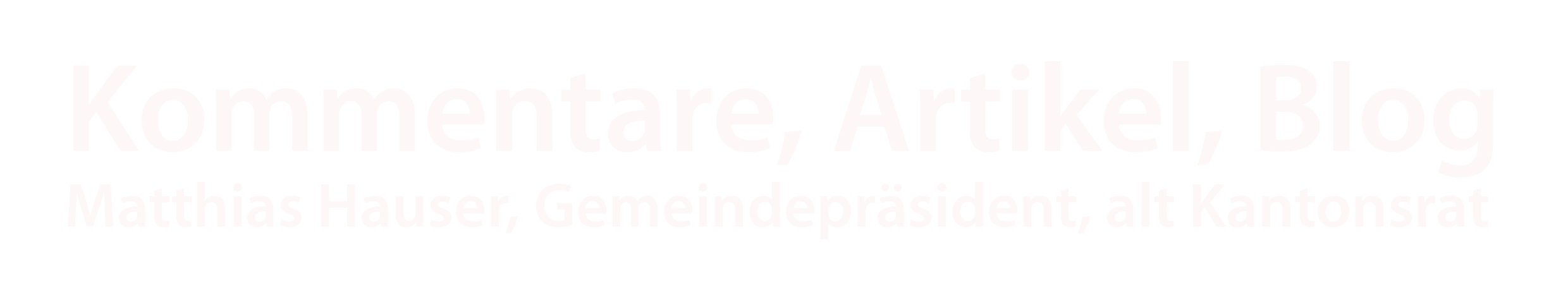Der folgende Artikel macht ersichtlich, welche Grundhaltungen die kantonale Budgetdebatte im Dezember prägen. Insgesamt wird klar, dass nur ein erneutes Zulegen der SVP in den Kantonsratswahlen 2007 die wirtschaftliche Zukunft sichert.
Vorab einige Zahlen zur finanziellen Lage des Kantons. Damit die Finanzplanung der Regierung aufgeht, wird optimistisch gerechnet: Bereits ohne die geplante Erhöhung des Steuerfusses soll der Steuerertrag in den kommenden zwei Jahren dank Aufschwung um 800 Millionen resp. um 19 % zunehmen. Unter dieser äusserst postiven Annahme sehen wichtige Eckwerte der Finanzplanung wie folgt aus:
Das zu verzinsende Fremdkapital steigt von 10,065 Milliarden Franken (Rechnung 2004) um über 1.3 Milliarden auf 11,430 Milliarden Franken (Plan 2009).
Das Eigenkapital wäre eigentlich Ende Jahr 2006 aufgebraucht, würden nicht 1.6 Milliarden Franken Golderlös dem Kanton zufliessen. Hätte der Kanton keine Sanierungsmassnahmen ergriffen (Sanierungsprogramm 2004, Massnahmeplan Haushaltsgleichgewicht 2006) ergäbe sich zudem ein Bilanzfehlbetrag (gemäss Finanzplan 2003 mit besserer Prognose aber ohne Sanierungsmassnahmen: 52 Millionen Franken im Jahr 2008). Diese Situation würde heissen, dass mehr als das gesamte Vermögen des Kantons eigentlich fremden Geldgebern gehört.
Im Jahr 2009 wird der Kanton nach einigen positiven Rechnungsabschlüssen (dank Sanierungsprogramm 2004, Massnahmeplan Haushaltsgewicht 2006, geplanter Steuerfusserhöhung um 5 % und Golderlös) trotz all diesen Massnahmen erneut ein Defizit von 206 Millionen Franken schreiben.
Die Verschuldung wächst und das Eigenkapital steht auf wackligen Füssen und wird ab 2009 wieder sinken. Das Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben bleibt bestehen. Wir konsumieren auf Kosten unserer Nachkommen, die dafür Steuern bezahlen werden, ohne Gegenleistungen zu erhalten. Oder der Kanton Zürich wird einst wichtige Leistungen nicht mehr bezahlen können und verlottert. Beides wären enorme Belastungen für den Wirtschaftsstandort mit Armutsfolgen. Finanzpolitik muss diese Entwicklung umkehren.
Die Irrtümer linker Finanzpolitik
In einer finanzpolitische Debatte im Zürcher Kantonsrat prallten am 26. September die unterschiedlichen Grundhaltungen zusammen. Dabei zeigte sich, dass die Ratslinke in einem widerlegten Muster denkt: „Wenn der Staat und die Wirtschaft in einem Tief stecken, dann muss der Staat investieren und darf erst recht nicht sparen, das kurbelt die Wirtschaft an“, so der Gedankengang. Diese immer wieder vorgebrachte Theorie funktioniert aus folgenden Gründen nicht:
Erstens hat die Theorie hat einen zweiten Teil, der lauten würde: „Wenn es dem Staat und der Wirtschaft gut geht, müssen Staatsausgaben aufgeschoben und Reserven gebildet werden, damit in Flauten ausgegeben und investiert werden kann“. Keynesianismus heisst diese staatsgläubige Politik der sieben fetten und sieben mageren Jahre. Die Umsetzung müsste in den fetten Jahren beginnen, und dies geschah nicht: Statt zukunftsbewusst zu haushalten wurden in unserem Kanton die Ausgaben laufend erhöht.
Zweitens bedingt die linke Theorie einen relativ geschlossenen Binnenmarkt. Es nützt dem Kanton nichts, wenn Geld der öffentliche Hand direkt oder über Umwege in andere Kantone und ins Ausland fliesst – so verflacht die ankurbelnde Wirkung. Wir leben nicht in einem geschlossenen Binnenmarkt.
Drittens müssten Ausgaben des Kantons diejenigen Branchen treffen, welche eine nachhaltige Produktivität entwickeln können, und über die kantonalen Aufträge hinaus mit Kaufkraft und Entwicklung den Wirtschaftskreislauf ankurbeln. Investitionen des Staates treffen aber vor allem die Baubranche, Ausgaben der laufenden Rechnung vor allem soziale Leistungen und die Bildung. Die ankurbelnde Wirkung dieser Branchen ist gering.
Steuererhöhungen führen zu höheren Sozialausgaben
Die linke Finanzpolitik unterliegt einem weiteren, erstaunlicherweise genau gegenteiligen, Irrtum: Der Wirtschaft soll Geld entzogen werden – Steuererhöhungen sollen zu höheren kantonalen Einnahmen führen. Dies bedeutet, dass alle Steuerzahler, also auch die meisten Leserinnen und Leser, einige hundert Franken weniger pro Jahr zum freien Ausgeben (und damit zum Ankurbeln der Wirtschaft) zur Verfügung haben. Unternehmen trifft ein höherer Steuerfuss mit tausenden Franken pro Jahr. Insgesamt entzieht die vom Regierungsrat geplante Erhöhung des Steuerfusses von 100 auf 105 Prozent der Wirtschaft jährlich 225 Millionen Franken. Jene natürlichen oder juristischen Personen, die sich bereits heute finanziell nur knapp über Wasser halten – und das sind einige – werden mit höheren Aufwendungen bei gleichen Erträgen als Steuerzahler wegfallen (auch infolge Konkurs). Wegfallen werden zudem sehr gute Steuerzahler, die sich günstigere Orte suchen. Stattdessen wird der Anteil an Empfängern von staatlichen Leistungen (Sozialhilfe u.a.) ansteigen. Der Staatshaushalt soll saniert werden, indem man die Wirtschaft drosselt? Das kann nicht funktionieren!
Ausgabewachstum und Wirtschaft im Gleichgewicht
Die bürgerliche Finanzpolitik setzt genau auf die gegenteiligen Pferde: Tiefe Steuern und weniger Staatsausgaben. Die Idee dahinter ist einfach zu verstehen, Private und Unternehmen sollen entlastet werden. Dies nicht nur, um gute Steuerzahler in unseren Kanton zu locken, sondern auch, damit das Geld, welches sonst für Steuern bezahlt würde und via Staat umverteilt wird, eben länger im möglichst unmittelbar wertschöpfenden Wirtschaftskreislauf für Umsätze sorgt. „Tieferer Steuerfuss = mehr Steuerzahler = höherer Steuerertrag“, lautet die Überlegung. Diese hat sich übrigens in der Praxis bestätigt. Der Steuerfuss wurde gesenkt, die Steuergesetze zu Gunsten von Privaten und Unternehmen geändert, und der Steuerertrag stieg zwischen 1998 und 2004 um 15 %.
Gesund ist der Staatshaushalt dann, wenn er nicht schneller wächst, als die Wirtschaft. Nur so können kantonale Leistungen immer gleichmässig finanziert werden, ohne der Wirtschaft, dem “Motor unseres Wohlstandes”, zu schaden. Damit sich das Wirtschaftswachstum und dasjenige des Staatshaushaltes treffen, reicht es nicht, nur anzukurbeln. Es geht nicht ohne strukturelle Reformen, welche die Ausgaben des Kantons senken. Dabei sind die Leistungen des Staates insgesamt zu verringern. Letztlich muss jeder von uns weniger Ansprüche an den Staat stellen und darf sich nicht von Politikern verführen lassen, welche kantonale Leistungen in Aussicht stellen. Wenn wir beispielsweise im Kantonsrat, wie kürzlich geschehen, beschliessen, dass Erwachsenenbildung zu den Aufgaben des Gemeinwesens gehört, so muss diese Leistungen bezahlt werden. Es gibt etliche weiteren Beispiele. Aufgaben eliminieren wäre viel klüger, als „an der Front“, in Krankenhäusern, Schulen oder bei der Polizei die Arbeitsbedingungen zu verschärfen. Doch immer wenn es darum geht, den Aufgabenkatalog des Kantons zu reduzieren, steht die SVP alleine und findet keine Mehrheit.
Golderlös soll Zinsaufwand senken
Übrigens ist die wohl unproduktivste Aufgabe des Kantons die Bezahlung von Schuldzinsen (“Passivzinsen”, 271 Millionen im Jahr 2004). Um diese zu reduzieren, sollten die 1.6 Milliarden Franken Golderlös der Nationalbank am sinnvollsten zur Rückzahlung von Fremdkapital verwendet werden. Doch was plant die Regierung: Zahlen der laufenden Rechnung werden mit Goldeinnahmen geschönt und wirklich strukturelle Reformen hinausgeschoben. Die SVP Initiative “Schluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer Kinder” will dies korrigieren.
Wahl zwischen SVP und Sanierung durch Zusammenbruch
Die bestehenden Leistungen des Kantons werden von über 40’000 vollen Stellen erbracht. Staatsangestellte sind zusammen mit ihren Familienangehörigen ein gewaltiges Wählerpotential. Wer für Leistungsabbau eintritt, wird von den Leistungserbringern kaum Stimmen ernten. Dies hat Konsequenzen: Je grösser der Staat, desto weniger wird es Politiker geben, welche ihn am Weiterwachsen hindern. Dieser verhängnisvolle Kreislauf führt letztlich zur Sanierung durch Zusammenbruch. Dieser Tragik schlittern wir entgegen, sie zu verhindern, ist eine Frage der Mehrheiten. Und damit ist der kommende Wahlkampf wichtig wie noch nie.